«Engadiner Post/Posta Ladina»: Stefan Kurath, gesetzt den Fall, Sie könnten im Bereich Raumplanung und Architektur in der Schweiz Grundlegendes verändern, was würden Sie tun?
Stefan Kurath*: Es ist vielleicht weniger der Wunsch, etwas verändern zu wollen, als vielmehr die Bestrebungen hin zu einer höheren Baukultur zu intensivieren.
Und was ist eine höhere Baukultur?
Wenn man beim und durchs Bauen Energie und Abfall möglichst stark reduziert, einen sorgfältigen Umgang mit verfügbarem Land und Ressourcen pflegt, mehr lokale Baumaterialien verwendet, Mittel wirtschaftlich einsetzt oder durch Planung Verkehr reduziert. Es gibt so viele Sachen, die man im Kontext von Qualität angehen sollte und bei dem das über 2000-jährige architektonische Wissen eingesetzt werden kann.
Was können Sie persönlich beisteuern?
Ich bin, seit ich mit 15 eine Lehre als Hochbauzeichner begonnen habe, auf das Thema sensibilisiert und seither auf diesem Gebiet tätig. Als Architekt, Forscher, Publizist oder auch Professor versuche ich diese Themen auf allen Ebenen verständlich zu machen. Eben habe ich in meinem neuesten Buch «jetzt: die Architektur!» (siehe Infotext weiter unten) an Beispielen der Therme Vals oder auch im Zusammenhang mit dem Kulturfestival Origen aufgezeigt, was eine höhere Baukultur ausmacht und auch, welche Auswirkungen diese hat. Und es ist natürlich ein zentrales Thema in der Lehre mit Studierenden, um auch die nächste Generation dahingehend zu sensibilisieren.
«Reine Fassade machen, ist das Ende von Architektur»
Sie behandeln im Buch auch die typischen Fragen, die im Zusammenhang mit Architektur immer wieder gestellt werden: Was ist gute Architektur? Was ist schön, was nicht, was sinnvoll und was nicht?
Darauf gibt es nicht die eine Antwort. Man kann aber zumindest erklären, wie es zu den verschiedenen Sichtweisen auf das, was gebaut wurde, kommt. Ganz ähnlich wie in der Kunst bestimmen auch in der Architektur verschiedene Diskursformen solche Einschätzungen. Die Frage, ob etwas gut oder schlecht gemacht ist, ist eine methodische und handwerkliche Frage, in welche zudem 2000 Jahre Architekturgeschichte mit hineinspielen und auch der ebenso alte Diskurs, wie etwas besser gemacht werden kann. Was gute Architektur in diesem Kontext ist, wird durch den Fachdiskurs an den Hochschulen, die Auseinandersetzungen in den Berufsverbänden, Besprechungen in Fachpublikationen oder auch an Fachveranstaltungen bestimmt. Natürlich gibt es auch die persönlichen Empfindungen von Personen, die sich nicht mit Architektur auseinandergesetzt haben und das Ganze anders wahrnehmen. Und klar, bloss weil ein Fachdiskurs zum Schluss kommt, etwas sei gute Architektur, muss es deshalb noch lange nicht allen gleichermassen gefallen. Aber auch nicht umgekehrt. Schön wäre ein gegenseitiges Verständnis.
Sehen Sie Unterschiede von einer Stadt zu einem Bergdorf, wo neue Architektur vielleicht schneller mit dem bestehenden Dorfbild oder den Vorstellungen eines perfekten Dorfbilds kontrastiert und entsprechend Konfliktpotenzial birgt?
Nein, denn es gelten für beide Orte die genau gleichen Kriterien für handwerkliche Fertigkeiten, im Umgang mit dem Bestand, in der lokalen Produktion, in lokalen Baumaterialien oder lokalem Handwerk, welche alle zusammen das Gesamtbild beeinflussen. Schaut man 150 oder 200 Jahre zurück, sieht man, dass Stadt- wie auch Dorfstrukturen damals vor allem von den eingesetzten Baumaterialien und von den technischen Möglichkeiten bestimmt waren. In der Stadt wie auch auf dem Land bestimmten Raumdimensionen von rund vier mal vier Meter die Grundstruktur der Einzelbauten.
Weshalb?
Weil das der Länge der zur Verfügung stehenden Baumstämme entsprach, die als Träger eingesetzt werden konnten. Vorhandene Materialien wie Stein und Holz haben die historischen Ortsbilder stark mitgeprägt. Zudem wurde direkt an der Strasse gebaut. Niemand hatte Ressourcen für Extraerschliessungen. Dies gilt für die Bauten der Dörfer im Engadin gleichermassen wie für die Häuser in den Städten.
Und heute?
Man bekommt praktisch jedes Material überall her, kann technisch fast alles machen. Das führt zu einer grossen Vielfalt, die sowohl sehr Schlechtes wie auch sehr Gutes ermöglicht. Vor 200 Jahren hat vieles sehr ähnlich ausgesehen, weil es weniger Möglichkeiten gab. Die Grösse von Glasscheiben war beschränkt, und zudem wollte niemand über eine schlechte Verglasung Wärme verlieren. Weil man möglichst den Strassenraum einsehen wollte, begann man, Fenster abzuschrägen und Erker zu bauen.
Mittlerweile scheint der Wert einheimischer Rohstoffe und heimischen Schaffens wieder zuzunehmen. Stimmt das?
In der Nachkriegszeit wurde natürlich versucht, die Möglichkeiten auszureizen, welche neue Technologien und Materialien boten. Beton kam damals entsprechend stark auf. Auch Metall war ein grosses Thema. Man hat mit diesen allzeit verfügbaren Mitteln versucht, die gesellschaftlichen Problemstellungen von damals anzugehen und zu lösen. Aktuell wandelt sich dies im Einfluss von Klimawandel, Wirtschafts- und Energiekrisen gerade gewaltig. Man überlegt sich wieder zweimal, was man wo herholt und wie verbaut.
«Es gibt nicht zu wenig Bauland»
Architektur wird in erster Linie von aussen wahrgenommen. Wie sehen Sie die Wirkung von Aussen- und Innensicht?
In der Architektur gibt es keine Trennung zwischen innen und aussen. Architekten sind vielmehr Generalisten, welche die Aufgabe haben, verschiedenste Partikularinteressen, die sich durchaus auch widersprechen können, in physischen Raum zu übersetzen. Ein Gebäude ist als Gesamtheit eigentlich ein multidimensionales Gebilde, das unterschiedlichste Dinge vereint und durch das architektonische Wissen in Form gebracht wird. Das Innere wie auch Äussere steht in Abhängigkeit zueinander wie auch zum Material, zu Strukturen, aber auch zu Bauherren- und Nachbarschaftswünschen. Eine Fassade ist so gesehen mehr Ausdruck des Gesamten als eine reine Gestaltungsaufgabe. Sollte Letzteres die Vorstellung von Architektur sein, ist das das Ende von Architektur.
Heute kommen energetische Aspekte hinzu. Gebäude sollen aktiv Energie sparen und auch Energie produzieren. Wie stark verändert dies die Architektur?
Grundsätzlich ist das nichts Neues, solcherlei Bestrebungen gibt es seit Menschengedenken. Es gibt auch in der heutigen Zeit sehr gute Beispiele, bei welchen ein sehr innovativer Umgang gefunden worden ist, und zwar in der Kombination von hochwertiger Architektur, die Energie einspart und produziert. Architekten können damit gut umgehen. Meine Erfahrung ist vielmehr, dass viele Bauherren so beginnen: Sie wollen ein Haus, das wie ein normales Haus ausschaut. Dann wünschen sie sich alle neuen technischen Errungenschaften im und auf dem Haus. Sobald aber die Baukosten vorliegen, werden solche Wünsche dann wieder von der Liste gestrichen. Zurück bleibt ein normales Haus. Von aussen wird den Architekten dann unterstellt, sie wollten sich nicht mit solchen Themen befassen. Die Herausforderung, erneuerbare Energien durch Gebäude zu nutzen und zu befördern, verhindert nicht eine gute Architektur. Man muss aber auch bereit sein, das Ganze zu sehen.
Architektur ohne Raumplanung, geht das?
Nein. Vor 1980 gab es kein Raumplanungsgesetz auf Bundesebene. Bis dahin wurde im Rahmen von Wohlstand und Überfluss verschwenderisch mit Landressourcen umgegangen. Das hat auch damit zu tun, dass der Einzelne, der nichts mit Raumplanung oder Architektur zu tun hat, sich meist nicht bewusst ist, welche Auswirkungen seine persönlichen Entscheide auf den Raum haben. Heisst, ein Bauherr hat das Bedürfnis, ein Haus zu bauen, hat ein Grundstück und will das dort realisieren. Dass er dieses Grundstück erschliessen muss, er damit Landwirtschaftsland beansprucht oder dass er danach weiter zur Arbeit fahren muss, sind alles Themen, die in der Entscheidungsfindung des Einzelnen nicht als problematisch angesehen werden. In der Summe führt dies aber zur Zersiedlung. Einem der grossen aktuellen Themen.
Sind wir ein Volk von Egoisten?
Es kann zumindest dazu führen, dass man seine Freiheiten, ohne es zu bemerken, auf Kosten der anderen auslebt. Planung wird leider allzu oft als Eingriff in die persönliche Freiheit empfunden. Erst wenn der Nachbar baut, wird die Wichtigkeit von Planung erkannt. Die Aufgabe der Raumplanung ist es, persönliche Entscheide mit Raumfragen in Verbindung zu bringen und zu verhindern, dass persönliche Freiheiten nicht auf Kosten anderer ausgelebt werden. Hierfür wünschte ich mir ein stärkeres Bewusstsein. Damit befinden wir uns auch schon mitten in den baukulturellen Gefilden, wo Baukultur als Gesamtsystem angeschaut und verstanden werden muss.
Und wo auch die Raumplanung mit hineinfliesst ...
Genau. Raumplanung hat einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen. Innenentwicklung beispielsweise basiert auf der Abstimmung mit der Revision des Raumplanungsgesetzes und ist entsprechend demokratisch abgestützt. Verbunden mit der Aufgabe, sorgsam mit dem vorhandenen Bauland umzugehen und sich nicht auf Kosten von Landwirtschaft, Kulturland und Biodiversität auszudehnen.
«Nur bauen alleine hat noch nichts mit Architektur zu tun»
Nun basiert auch das Zweitwohnungsgesetz auf einem demokratischen Entscheid. Aber die beiden Gesetze kommen sich immer mehr in die Quere. Auch im Engadin, wo die Wohnraumproblematik akut ist, Einheimische sich Wohnungen in den Dorfzentren nicht mehr leisten können, aus diesen verdrängt werden, aber andernorts – auf der grünen Wiese – nicht mehr bauen dürfen. Kennen Sie die Situation im Engadin?
Ja, ich habe mich sehr intensiv mit der dortigen Situation befasst. Es sind zum Teil katastrophale Zustände mit Folgen wie Abwanderung und Personalmangel. Da wird immer wieder die Raumplanung dafür verantwortlich gemacht. Jetzt ist es aber so, dass die Innenentwicklung und die Begrenzung der Bauflächen bis hin zur Rückzonung hauptsächlich damit zu tun hat, dass in den 1970er-Jahren einfach viel zu viel Land eingezont wurde. Heisst, man hat viel mehr Bauland eingezont, als der gesetzlich vorgegebene, 15-jährige Entwicklungshorizont vorsieht. Die Rückzonung versucht heute, den Fehler zu grosser Bauzonen rückgängig zu machen, sie verhindert aber eine funktionierende Raumentwicklung nicht. Es gibt demnach nicht zu wenig Bauland. Das Problem liegt vielmehr in der Verfügbarkeit von Bauland, der Baulandhortung.
Wer blockiert Bauland?
Es sind Leute, die ihr Land irgendwann mal weitervererben wollen oder das Land nicht überbauen, weil die Finanzen oder der Bedarf fehlen. Das blockiert die Entwicklung. Es macht keinen Sinn, wenn man an bester Lage jahrzehntelang Bauland hortet und dafür an anderer Stelle immer weiter ins Landwirtschaftsland bauen muss.
Also wäre Eigenverantwortung gefragt?
Natürlich. Es sind die liberalen Geister, für die ich als Liberaler durchaus auch Verständnis habe, welche das als Einschränkung ihrer persönlichen Entscheidungsfreiheit sehen. Man kann das Problem aber nicht lösen, indem man quasi alle Schleusen öffnet. Das funktioniert einfach nicht. Man kann stattdessen selber entwickeln, Baurechte vergeben, verkaufen oder abtauschen. Das wäre verantwortungsvoll.
Und die Zweitwohnungs-Gesetzgebung?
Die Zweitwohnungs-Initiative strebt ein gesundes Verhältnis zwischen Erst- und Zweitwohnungsangebot an. Die Umgehung der Zweitwohnungs-Initiative basiert auf einer Gesetzeslücke, wonach altrechtliche Erstwohnungen in Zweitwohnungen umgewandelt werden können. Hinzu kam eine massive gesteigerte Nachfrage nach Wohnungen durch die Auswirkungen der Pandemie und andere gesellschaftliche Entwicklungen, was dazu führt, dass plötzlich Preise erzielt werden, die sich viele Einheimische nicht mehr leisten können. Eine Situation, die aber auch den Einheimischen selbst anregt, seine Immobilie möglichst teuer und nicht an Einheimische zu verkaufen.
Weil dieser sich selbst der Nächste ist und Partikulärinteressen verfolgt?
Es ist ja nicht irgendwer, der altrechtliche Wohnungen umschreibt und verkauft. Einerseits will man maximal vom Verkauf profitieren oder hortet Bauland und jammert gleichzeitig, die Raumplanung verhindere alles. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Da muss klipp und klar gesagt werden, man kann nicht eigennützige Entscheide fällen und gleichzeitig die Verantwortung auf alle anderen abschieben. Das funktioniert einfach nicht. Auch nicht im Engadin.
«Es braucht eine Anpassung der Baugesetzgebung»
Und auch die Nachbarschaft schaut nicht einfach zu ...
Tatsächlich kommt es bei der Innenentwicklung oft zur Situation «not in my backyard», eine klassische Reflexhaltung. Veränderung vor der eigenen Haustüre ist nicht sehr beliebt. Dieses System kommt dann an seine Grenzen, wenn es einen gesellschaftlichen Auftrag gibt, a, die Innenentwicklung zu fördern und, b, Erstwohnungen zu bauen, die im Engadin unbestritten und dringend notwendig sind. Nur bauen alleine hat noch nichts mit Architektur und hoher Baukultur zu tun. Umso mehr gilt es gerade innerorts, die architektonisch, gestalterische und raumplanerische Qualität sicherzustellen. Insbesondere auch im Zusammenhang von Ortsbild und Ortsbildschutz. Dafür gibt es aber klare Prozesse, Vorgehensweisen und auch Kriterien.
Womit wir wieder bei der Frage sind, was ist gute, was ist schöne Architektur? Ich behaupte mal, dass heute niemand mehr ein Pseudo-Engadinerhaus fordert, bloss um dem Dorfbild gerecht zu werden. Wie sehen Sie das?
Das sind keine Kriterien für gute Qualität. Es geht weder um Historismus noch um eine romantisierende Bauweise, sondern es geht einzig um hohe Bauqualität und Baukultur. Wenn das richtig gemacht ist, dann trägt dies sehr viel. Auch Zeitgenössisches. Wichtig ist, dass die Prozesse richtig angegangen werden. Das bedeutet, dass man beispielsweise über ein Wettbewerbsverfahren eine Auswahlmöglichkeit hat, dass nicht das erstbeste Projekt gebaut wird, sondern dass man nach dem besten Projekt sucht. In diesen Entscheid sind idealerweise die verschiedenen Betroffenen und entsprechende Fachleute involviert, welche den Diskurs – über das Richtige an diesem Ort – auch führen und diesen Diskurs transparent gestalten. Das sind Anforderungen, auf die leider gerne verzichtet wird. Man hat Angst, dass der Bau zu teuer kommt oder die Zeit dazu fehlt. Tatsächlich verursachen aber hinten hinaus Bauverzögerungen, beispielsweise durch Einsprachen, einen viel grösseren Zeitverlust und damit höhere Kosten als ein sauberer Entwicklungsprozess. Aber das sehen viele leider nicht ein, weil sie auch die Forderung nach Qualität als Eingriff in die persönliche Freiheit empfinden.
Aber kommen private Bauherrschaften oder Genossenschaften auf die Idee, einen Architekturwettbewerb zu lancieren? Die setzen sich doch mit dem oder der Architektin des Vertrauens zusammen und vergeben so den Auftrag.
Das kommt natürlich auch auf die Aufgabe an. Beim Bau eines Einfamilienhauses in einer Siedlung ist das was anderes als in einem intakten Ortsbild oder bei öffentlichen Bauten. Grundsätzlich haben wir gegenüber unserer Umwelt eine gesellschaftliche Verantwortung, einen Diskurs zu führen, was gut und richtig ist und einen mehrheitsfähigen, transparenten Prozess abzubilden. Wichtiger als die Frage, ob das jedem Einzelnen persönlich gefällt oder nicht, ist, dass nicht jemand alleine über etwas bestimmt, das sich die anderen tagtäglich ansehen müssen.
Neben Bauherren, Planern und Architekten sind auch Gemeinden und ihre Behörden mit im Spiel. Schlussendlich sind sie die Bösen, wie immer sie einen Bauentscheid auch fällen.
Auf Stufe Baugesuch ist es eben bereits zu spät, da kann in der Regel nichts mehr geändert werden. Es ist ein Fehler im Ablaufprozess, wenn etwas erst angeschaut wird, wenn schon alles entschieden ist. Da verstehe ich den Bauherren, der kein Interesse daran hat, einen solchen Prozess nochmals von vorne zu beginnen.
Braucht es Anpassungen im Baugesetz?
Ja, denn unsere Baugesetze gründen noch auf den 1970er-Jahren mit ganz anderen Herausforderungen. Damals baute man auf die grüne Wiese und hatte gänzlich andere Problemstellungen als jetzt bei der Innenentwicklung. Bei Letzteren bräuchte es meiner Meinung nach eine vorgängige Austauschpflicht, bevor überhaupt der erste Strich gemacht wird. Damit meine ich aber nicht einen behördlichen Eingriff, sondern eine Auslegeordnung der verschiedenen Interessen. Die kommen nämlich früher oder eben oft zu spät, eh ins Spiel.
Beispielsweise Gemeinde oder Nachbarn?
Ja, denn die Gemeinde kommt als Bewilligungsbehörde ohnehin ins Spiel, und die Nachbarn schauen als Einspracheberechtigte auch genau hin. Wenn diese ihre Interessen aber schon von Beginn weg mit einbringen können, wird das Projekt vielleicht anders umgesetzt, und wenn von Beginn weg klar ist, dass Qualitätskriterien erfüllt werden müssen, dann ist auch der Planungsprozess ein anderer.
«Es gibt keine Garantie für reibungslose Planungen ...»
«... und auch kein Recht auf freie Aussicht»
Kommt hinzu, dass Baubehörden oft nicht professionell aufgestellt sind und deshalb auch mal überfordert sein können. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, denn da sind wir bereits bei der nächsten Problemstellung, dem Milizsystem. Das ist auf der politischen Ebene ja grundsätzlich eine wunderbare Angelegenheit. Aber bei Fachthemen wie eben der Baugesetzgebung oder Fragen der Baukultur fehlt den entsprechenden Behörden und Gemeindeverwaltungen oft das nötige Bewusstsein. Umso notwendiger wäre es, dass man gewisse fachliche und qualitätssichernde Aufgaben regional und damit im grösseren Kontext löst, wo auch eine gewisse Themenmasse anfällt und ein Zusammenhang entsteht, um eine Gemeindegrenzen überschreitende Planung und Raumqualität zu erreichen.
Also eine regionale Gestaltungskommission?
Beispielsweise im Sinne von regionaler Fachberatung oder fachlicher Unterstützung. Regionale Planungsverbände und -kommissionen gibt es ja bereits, ohne dass föderale Strukturen infrage gestellt werden. Das kann bis hin zu einer regionalen Bauverwaltung gehen. Da lohnt es sich auch, qualifizierte Personen einzustellen.
Heute kennen die Gemeinden den Bauberater, die Bauberaterin. Hier allerdings fällt meist eine Einzelperson ein Urteil, was wiederum Konfliktpotenzial birgt.
Wenn eine einzelne Fachperson entscheidet, was gut oder was nicht gut ist, dann kann sich der Betroffene zu Recht fragen, ob das nicht willkürlich ist. Ich plädiere stattdessen für einen Diskurs, für eine Diskussion über Qualität, in der mehrere Personen involviert sind, die einen gemeinsamen Entscheid fällen, welchem Argumente zugrunde liegen und der auf verschiedenen Sichtweisen und Ansprüchen breit abgestützt ist.
Wird unter solchen Vorzeichen überhaupt noch etwas gebaut, werden noch Ideen realisiert? Wenn eine interessierte Bauherrschaft den Weg über eine regionale Gestaltungs- oder Planungskommission gehen muss?
Das ist eine Massnahme von verschiedenen, bereits angesprochenen Möglichkeiten. Und sicher auch nicht für jedes Bauvorhaben die richtige. In der Regel werden ja Bauberaterinnen eingesetzt, weil sonst in den Gemeinden niemand eine Qualitätssicherung durchführen kann. Warum die einzelnen Bauberater der Gemeinden also nicht zu einer regionalen Gestaltungskommission zusammenführen? Es sollte zudem nichts Zusätzliches sein, sondern veraltete Verfahren und Prozesse müssten ersetzt werden. Aber noch einmal, bei einem sauber aufgegleisten Entwicklungsprozess mit der frühen Einbindung relevanter Akteure, mit transparentem Varianzverfahren braucht es die Bauberater und die Gestaltungskommissionen nicht mal. Da werden ja über das Wettbewerbsverfahren und den Juryprozess sehr früh die Weichen für die Qualität gestellt. Dann bleibt auch beim Bewilligungsgesuch nur noch die Kontrolle, ob das eingereichte Projekt noch etwas mit dem einstigen Wettbewerbsprojekt zu tun hat oder nicht.
Und seitens der Nachbarn?
Da gilt grundsätzlich das Gleiche. Wenn Nachbarn am Anfang gewisse Interessen einbringen können, gibt es vielleicht keine oder weniger Einsprachen. Es gibt grundsätzlich keine Garantie für reibungslose Planungen. Aber wenn weiterhin jeder versucht, möglichst alle auszugrenzen, die irgendwie etwas beeinflussen könnten, was man selbst nicht will, dann kommen die Anliegen der Ausgegrenzten früher oder später zurück.
Also frei nach dem Motto, lieber sofort alle an einen Tisch bringen, als im Nachhinein miteinander streiten?
Man sollte zumindest versuchen, eine Auslegeordnung zu machen. Und wenn sich dann eine Partei völlig querstellt, findet, man dürfe gar nichts machen, dann kann man diese immer noch ausgrenzen. Es gibt kein Recht auf freie Aussicht. Wenn aber einem Nachbarn die Aussicht von seinem Wohnzimmer aus auf den Hausberg sehr wichtig ist, dann kann man gegebenenfalls reagieren und darauf Rücksicht nehmen.
Der nachfolgende Teil des Interviews steht nur online zur Verfügung.:
Welche Rolle bietet sich Architekten an?
Es gehört eben gerade zur Aufgabe von Architekten, durch ihre Praxis unterschiedliche, sich widersprechende Interessen zusammenzubringen. So ist es auch möglich, auf konkret formulierte Anliegen eines Nachbarn einzugehen. Solange dieser nicht einfach grundsätzlich gegen ein Projekt ist, gehört das zum Handwerk eines Architekten oder einer Architektin, auch mit diesem Anliegen eine gute Lösung zu finden oder wenigstens verständlich darzustellen, weshalb das nicht geht.
Der Architekt, die Architektin in der Pflicht ...
... mehr noch, es ist die Aufgabe des Architekten. Die Aufgabe lautet nicht, für sich das schönste Haus zu bauen, sondern das schönste Haus zu bauen unter Berücksichtigung möglichst vieler Rahmenbedingungen. Dafür sind Architekten ausgebildet. Aber es braucht das Varianzverfahren, weil jeder Architekt auch mal einen schlechten Tag haben kann, und jeder und jede kann eine Sachlage anders einschätzen. Mit einer Auslegeordnung von verschiedenen Projektvorschlägen kann man das beste Projekt auswählen. Man ist dann nicht wie beim Direktauftrag abhängig von Laune und Form eines Architekten.
Aber Wettbewerbe kosten, und nicht jede Bauherrschaft wird das wollen oder sich leisten können.
Wir sprechen von grossen Bauten im Umfang mehrerer Millionen. Wenn man da die Wettbewerbskosten zwischen 100 000 und 300 000 Franken je nach Projektgrösse betrachtet, dann sind das absolut vernachlässigbare Beträge. Und vergleicht man diese Ausgaben mit Rechtsverfahren und den Kosten, die ein Jurist verursacht, der alle Verfahrensebenen bis vors Bundesgericht durchläuft, dann ist Wettbewerbsgeld gut investiertes Geld.
«Wettbewerbsgeld ist gut investiertes Geld»
Stichwort Rechtsverfahren. Wir sprachen von Milizpolitikern und überforderten Behördenmitgliedern, die bei jeder Entscheidung juristisch angreifbar werden. Kein Wunder, stellen sich immer weniger für solche Ämter zur Verfügung.
Es ist meist eine sehr persönliche Sache. Leute, die in Gemeinden in politische Ämter gewählt sind und eigentlich Verantwortung übernehmen müssten, geraten oft in persönliche Konflikte, wenn sie gegen Leute entscheiden müssen, mit denen sie ansonsten im Alltag gut auskommen oder ihnen sogar nahestehen. Diese Verantwortungsbereitschaft ist klar gesunken, übrigens so schnell, wie die Empörungsbereitschaft gestiegen ist. Das sind gesellschaftliche Probleme und Konflikte, die massiv zugenommen haben. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn Personen, die ein solches Amt übernehmen, auch den nötigen Respekt erfahren. Immerhin arbeiten sie für die Gesellschaft. Heute versucht stattdessen jeder, seine persönlichen Interessen mit allen möglichen Mitteln durchzusetzen. Beispielsweise mit Juristen, die das durchaus auch noch bewirtschaften. Aus meiner Sicht besteht da ein grundlegendes gesellschaftliches Problem.
Aber ein lösbares Problem?
Wie weiter, wäre vielmehr die Frage. Es kann ja nicht sein, dass man aufgrund dessen, dass keiner mehr Verantwortung übernehmen will und jeder sich sofort über alles empört, alle Massnahmen zurückfährt und sagt, dann macht doch, was ihr wollt. Dann zerstört sich die Gesellschaft von selbst.
Haben Sie, Stefan Kurath, ein Rezept für eine bessere Zukunft?
Rezepte gibt es keine. Aber es gibt Formen des Umgangs, des Prozesses, der Kommunikation oder auch Formen von Bewusstsein und Selbstkritik. Wenn man diesen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess annimmt und sich alle in ihrer jeweiligen Rolle und mit ihren Kompetenzen einbringen würden, wenn man sich also viel früher miteinander am Tisch austauschen würde, anstatt später vor Gericht, wäre sehr viel mehr möglich. Grundsätzlich ist jede Form von Bauen immer ein Experiment. Es kann grandios scheitern oder auch hervorragend gelingen. Der Kanton Graubünden ist nicht umsonst für seine hohe Bauqualität und Baukultur höchst bekannt. Da gibt es sowohl alte wie auch neue Bauten, die alle Ansprüche und Formen erfüllen. Da gibt es keinen Grund zu glauben, man würde das nicht hinbekommen. Aber es liegt in einer gesellschaftlichen und baukulturellen Verantwortung und muss auf dieser Ebene Verständnis erhalten. Gerade in einem Kanton, in dem der Tourismus von einer wunderbaren Kulturlandschaft profitiert. Schliesslich wird sie durch schlechtes Bauen zerstört.
Übrigens, womit beschäftigen Sie sich gerade aktuell?
Unter anderem mit der Frage, wie man Mehrwert durch Architektur aufzeigen kann. Nicht nur aus ästhetischen Gesichtspunkten, sondern vor allem aus wirtschaftlichen.
Und, kann man das?
Eine aktuelle Meta-Studie hat 300 Studien ausgewertet und ist beim Vergleich von hoher Baukultur und Rendite zum Schluss gekommen, dass eine ausgewiesene hohe Baukultur eine höhere Rendite generieren kann. Es ist also auch für alle finanzaffinen Personen beweisbar, dass Baukultur einen wirtschaftlichen Effekt hat. Das kann man übrigens ganz einfach auch am Beispiel der Therme Vals nachzeichnen. Dort sind die Übernachtungszahlen nach der Eröffnung der Therme massiv gestiegen. Oder auch am Bergrestaurant Chäserrugg im Toggenburg oder auch am Beispiel des neuen Unterhaltsstützpunktes des kantonalen Tiefbauamts auf dem Berninapass, welches Architektur- und Kulturbegeisterte gleichermassen anzieht. Letzteres ein fantastisches Projekt, hervorgegangen aus einer nicht einfachen Aufgabenstellung und einem gut organisierten Architekturwettbewerb (Stefan Kurath hat beim Architekturwettbewerb selbst ein Projekt eingereicht, diesen aber nicht gewinnen können. Anm. d. Red.).
«Gute Baukultur hat nachweislich einen wirtschaftlichen Effekt»
Zurück zur Bündner Baukultur. Auf was führen Sie die erwähnt hohe Qualität zurück?
Einerseits auf die Wettbewerbskultur bei öffentlichen Bauten beim Kanton und den Gemeinden, vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren. Und auch auf die vielen Bauten wie beispielsweise den temporären Origen-Turm auf der Julierpasshöhe oder den Werkhof auf dem Berninapass, die ausserhalb der Bauzonen entstanden sind. Dort ist der Qualitätsanspruch eine Voraussetzung. Und ohne diesen Anspruch gibt es solche Bauten nicht.
Weil auch besser hingeschaut wird ...
Ja, vor allem aber, weil all die erwähnten Bauten Architekturwettbewerben entsprungen sind oder von Bauberatern auf ihre Qualität hin geprüft worden sind. Ganz einfach gesagt, verhindern Wettbewerbe, Baukommissionen und Bauberatungen dumme Ideen. Gute, innovative Ideen verhindern sie hingegen nicht. Das Problem ist, dass viele mit dummen Ideen kommen, sich ärgern, dass sie die Idee nicht umsetzen können und dann Schuldige suchen. Ich verstehe Raumplanung und Wettbewerb als Fördermassnahmen für gute Projekte, die nicht nur schön sind, sondern am Schluss noch Rendite abwerfen – wenn man diese denn zu nutzen weiss.
*Stefan Kurath (46) ist Schweizer Architekt und Urbanist. Er studierte an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur (ZHAW) und an der Academie van Bouwkunst Amsterdam sowie an der ETH Zürich. Seit 2012 lehrt und forscht er als Professor für Architektur und Entwurf am Studiengang Architektur der ZHAW und leitet dort seit 2014 zusammen mit Regula Iseli das Institut Urban Landscape. Parallel dazu arbeitet er als selbstständiger Architekt und Urbanist in Zürich sowie in einer Bürogemeinschaft mit Ivano Iseppi in Thusis. In seiner eigenen Forschungsarbeit widmet sich Kurath den Grenzen und Chancen der architektonischen und städtebaulichen Praxis. Stefan Kurath ist auch Autor zahlreicher Fachpublikationen. Zuletzt erschien das Buch «jetzt: die Architektur!» (siehe unten)
INFOTEXT
«jetzt: die Architektur!» Was ist richtig, was ist gut?
Ausgehend davon, dass es die «Autonomie der Architektur» so, wie sie in Theorie, Geschichte und Lehre vermittelt wird, nicht gibt, setzt sich der Architekturprofessor, Urbanist und Fachautor Stefan Kurath im Buch «jetzt: die Architektur!» mit Wirkung und Möglichkeiten der architektonischen Praxis auseinander.
Kritisch und fundiert hinterfragt und analysiert er sowohl die «richtige Stadt» wie auch die «gute Architektur», beleuchtet den Stellenwert des Berufsstandes des Architekten und erläutert, wie Architektur wieder relevanter und für alle Menschen ein Gewinn werden kann. Er gliedert dazu sein Buch in die drei Teile: Kritik, Forschung und Position, verspricht «eine andere Sichtweise auf vermeintlich Bekanntes» und zeichnet ein umfassendes Bild davon, was gute Architektur und guten Städtebau auszeichnet, welche positive Wirkung sie auf Stadt- und Grünräume, auf Mensch und Umwelt, aber auch auf Wirtschaft und Tourismus haben könnte – wenn eben Architektinnen und Architekten von der «Autonomie der Architektur» Abschied nehmen würden.
Stefan Kurath «jetzt: die Architektur!» Über Gegenwart und Zukunft der architektonischen Praxis, 2021, Park Books, Zürich. 256 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Plänen. ISBN 978-3-03860-242-2.
Interview und Fotos: Jon Duschletta












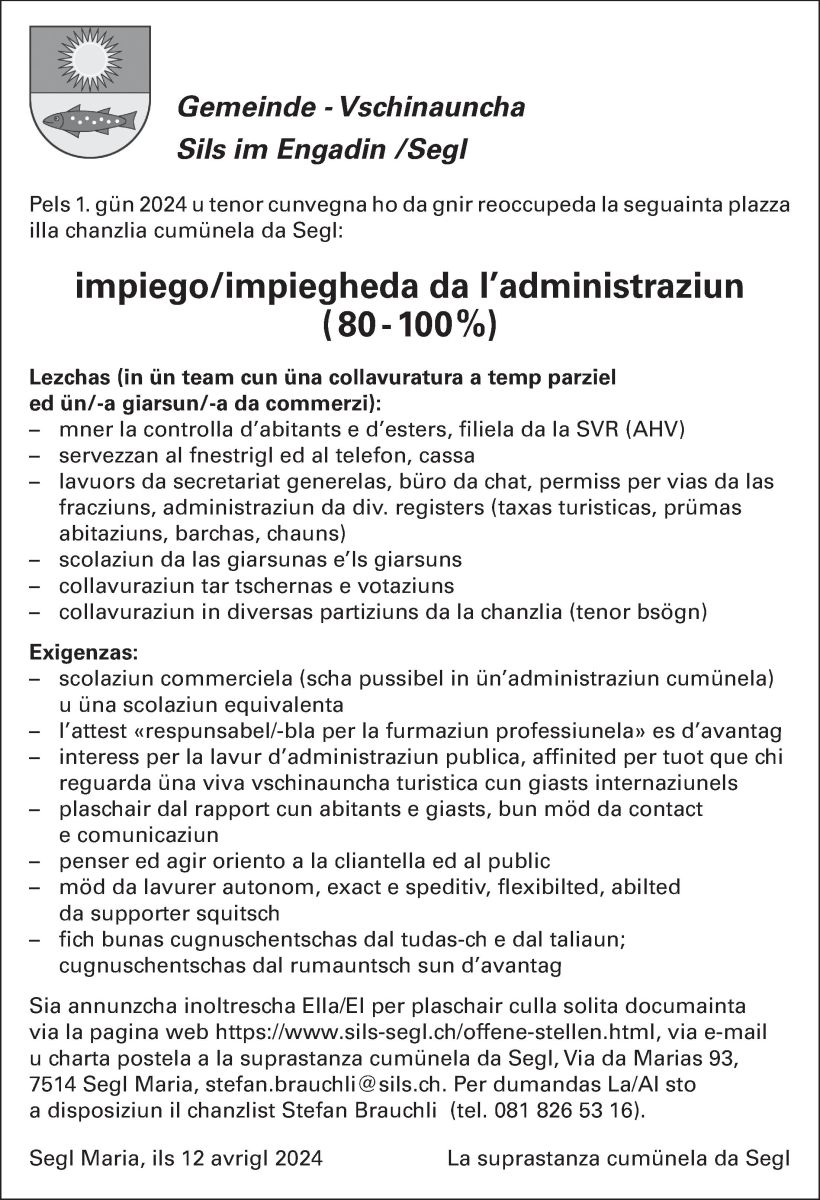



Diskutieren Sie mit
anmelden, um Kommentar zu schreibenNoch keine Kommentare