Kürzlich hat das Schweizer Gletschermessnetz (Glamos) die Daten der Schneemessungen auf 14 Schweizer Gletschern in diesem Frühjahr veröffentlicht. Vereinfacht gesagt werden die Gletscher im Sommer weniger stark schmelzen und an Masse verlieren, je höher die Schneeschicht ist. Zum einen dient der Schnee als natürlich Isolationsschicht, zum anderen ist der Schnee, der in höheren Lagen fällt und nicht wegschmilzt, die eigentliche Nahrung für den Gletscher, weil aus dem Schnee nach einem mehrjährigen Prozess später neues Gletschereis wird.
Gemäss den Daten von Glamos lag die Schneedecke bei allen vermessenen Gletschern 12 bis 60 Prozent über den Werten der Referenzperiode von 2010 bis 2020. Gemessen haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler je nach Gletscher an 50 bis 200 verschiedenen Orten mit jeweils zwei bis drei Schneetiefenmessungen. Überdurchschnittlich viel Schnee liegt unter anderem auf den beiden Engadiner Gletschern Murtel und Pers. Dies dank den häufigen Niederschlägen von Oktober bis Dezember 2023 und dann wieder von März bis Mai in diesem Jahr. Extrapoliert auf die rund 1400 Gletscher in der Schweiz entsprechen die durchschnittlich 31 Prozent mehr Schnee dem zweithöchsten Wert der letzten 20 Jahre. «Es ist davon auszugehen, dass der Massenverlust in diesem Jahr geringer ausfallen dürfte als noch in den beiden Vorjahren», schreibt der Wetterdienst Meteonews zu den Daten von Glamos.
«Das sind gute Neuigkeiten», sagt der Samedner Glaziologe Felix Keller. Der Schnee dieses Winters mache die Hälfte der «Miete» aus. Ein sehr heisser, niederschlagsarmer Sommer könnte aber die positive Winterbilanz noch trüben. «Darum hoffen wir, dass es nicht zu warm wird und dass der Sommer in den Höhenlagen ab und zu Schnee bringt.» Keller gibt weiter zu bedenken, dass ein positives Jahr in Bezug auf die Massenbilanz, also das Volumen eines Gletschers, noch nichts aussagt. Der Morteratschgletscher braucht 20 Jahre, bis er nach mehreren positiven Jahresmassenbilanzen wieder vorstösst.»
Gemäss den Daten von Glamos lag die Schneedecke bei allen vermessenen Gletschern 12 bis 60 Prozent über den Werten der Referenzperiode von 2010 bis 2020. Gemessen haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler je nach Gletscher an 50 bis 200 verschiedenen Orten mit jeweils zwei bis drei Schneetiefenmessungen. Überdurchschnittlich viel Schnee liegt unter anderem auf den beiden Engadiner Gletschern Murtel und Pers. Dies dank den häufigen Niederschlägen von Oktober bis Dezember 2023 und dann wieder von März bis Mai in diesem Jahr. Extrapoliert auf die rund 1400 Gletscher in der Schweiz entsprechen die durchschnittlich 31 Prozent mehr Schnee dem zweithöchsten Wert der letzten 20 Jahre. «Es ist davon auszugehen, dass der Massenverlust in diesem Jahr geringer ausfallen dürfte als noch in den beiden Vorjahren», schreibt der Wetterdienst Meteonews zu den Daten von Glamos.
«Das sind gute Neuigkeiten», sagt der Samedner Glaziologe Felix Keller. Der Schnee dieses Winters mache die Hälfte der «Miete» aus. Ein sehr heisser, niederschlagsarmer Sommer könnte aber die positive Winterbilanz noch trüben. «Darum hoffen wir, dass es nicht zu warm wird und dass der Sommer in den Höhenlagen ab und zu Schnee bringt.» Keller gibt weiter zu bedenken, dass ein positives Jahr in Bezug auf die Massenbilanz, also das Volumen eines Gletschers, noch nichts aussagt. Der Morteratschgletscher braucht 20 Jahre, bis er nach mehreren positiven Jahresmassenbilanzen wieder vorstösst.»


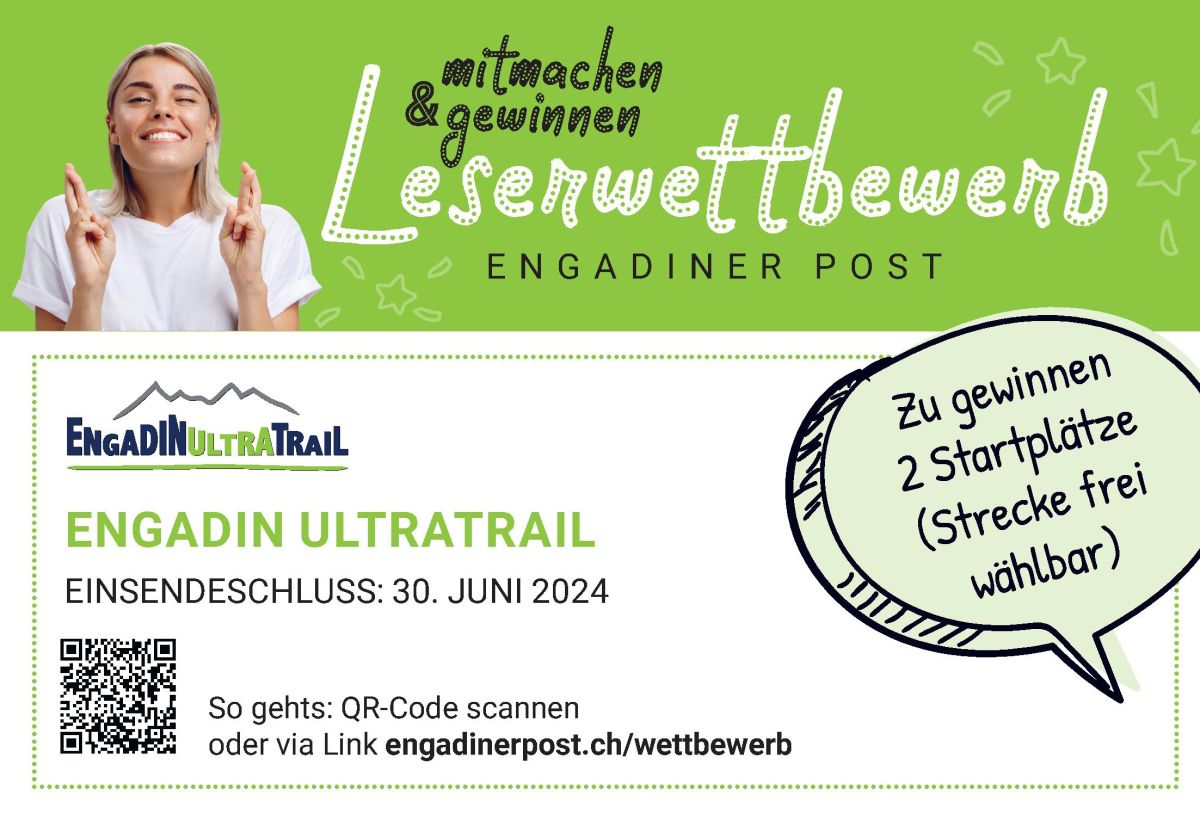

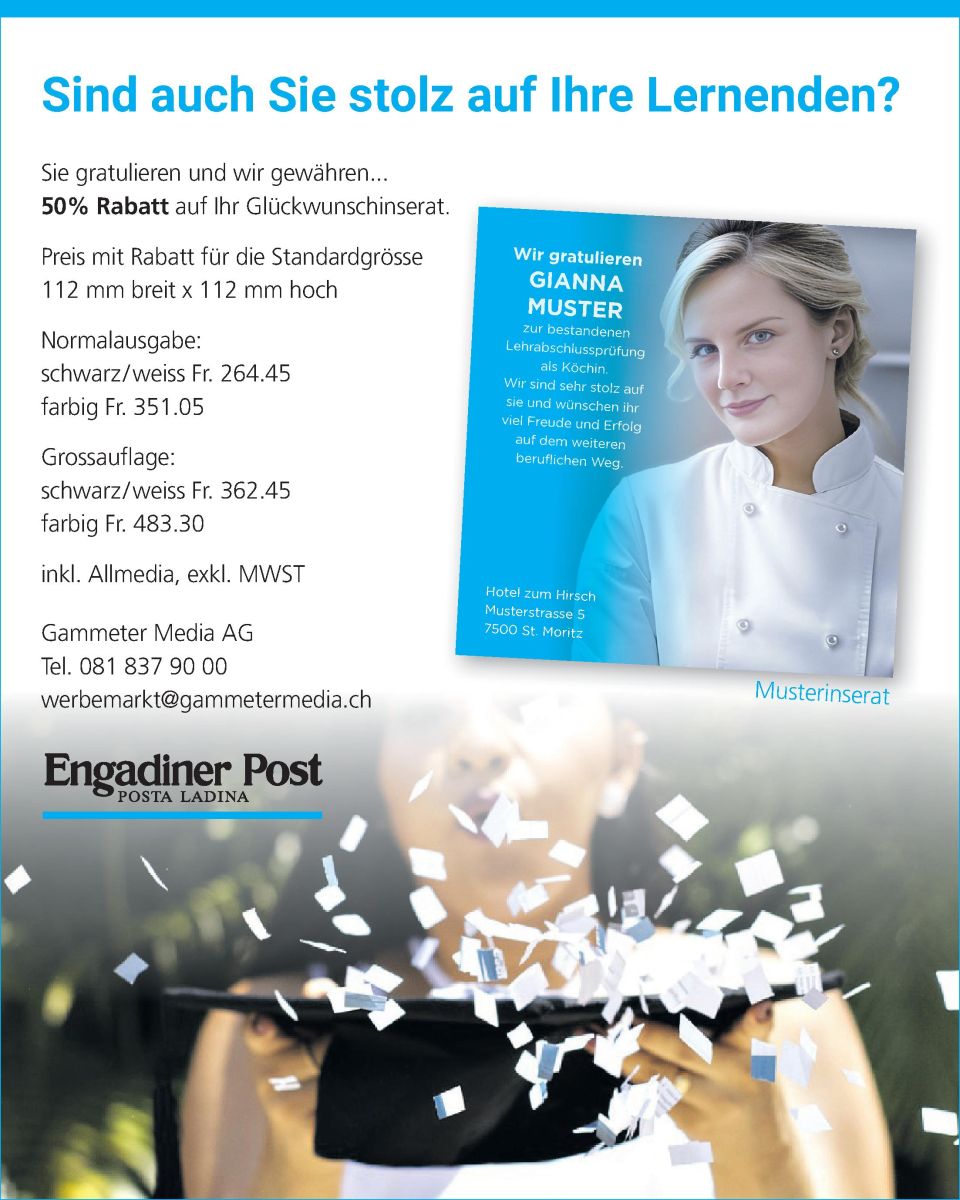
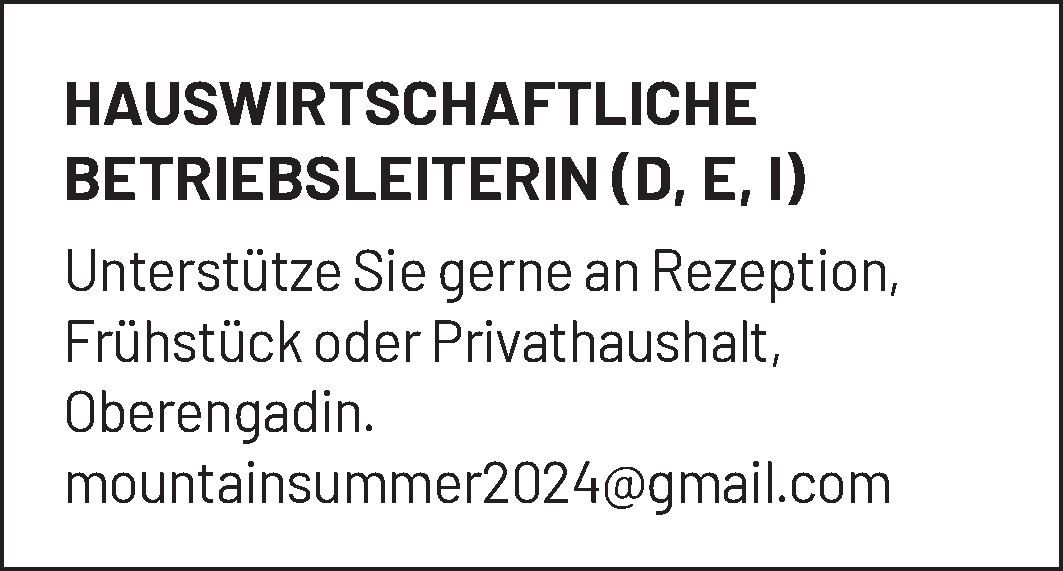
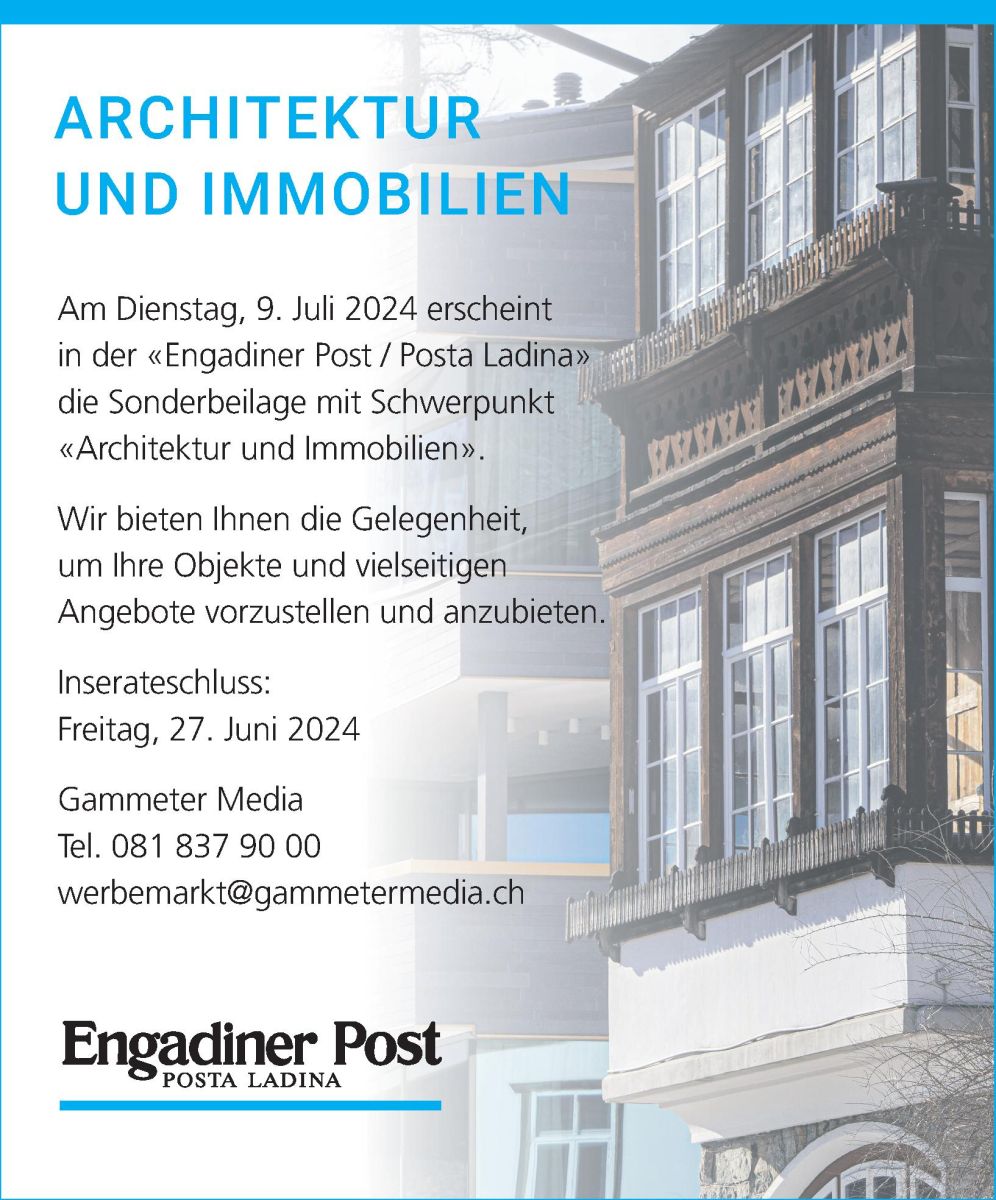








Diskutieren Sie mit
anmelden, um Kommentar zu schreiben